Japan vs. Deutschland – Immobilienmärkte im Vergleich
- Marc André Sieber

- 22. Sept.
- 2 Min. Lesezeit
Das Team der Apex Real GmbH hatte kürzlich die Gelegenheit, den japanischen Immobilienmarkt vor Ort zu analysieren. Der direkte Blick in ein völlig anderes Marktumfeld macht deutlich, wie stark Immobilienökonomie von Kultur, Demografie und gesellschaftlicher Haltung geprägt ist. Gleichzeitig ergeben sich spannende Impulse für den deutschen Markt.
1️⃣ Gebäudelebenszyklen
In Japan werden Wohngebäude durchschnittlich bereits nach 25–30 Jahren abgerissen und durch Neubauten ersetzt. Der Wert einer Immobilie bemisst sich daher primär am Grundstück und weniger am Bestand. Diese Haltung führt zu einem stetigen Neubausektor mit hoher Innovationsgeschwindigkeit – architektonisch wie technologisch. In Deutschland dagegen rückt der Bestand immer stärker in den Mittelpunkt: energetische Sanierungen, ESG-Kriterien und CO₂-Reduktion bestimmen die Diskussion. Der Vergleich zeigt, wie unterschiedlich Märkte mit der Frage umgehen, ob bestehende Gebäude als Ressource oder als temporäre Lösung betrachtet werden.
2️⃣ Urbanisierung und Demografie
Rund 92 % der japanischen Bevölkerung lebt in Städten. Megaregionen wie Tokio, Osaka oder Nagoya bündeln Kapital und Nachfrage, während ländliche Regionen rapide an Bedeutung verlieren. In Deutschland lässt sich ein ähnlicher, wenn auch schwächerer Trend erkennen: A-Städte ziehen Menschen und Investitionen an, während viele Mittelstädte und ländliche Regionen mit Leerständen und Überalterung kämpfen. Für Projektentwickler und Investoren stellt sich in beiden Märkten die gleiche Frage: Wo entstehen künftig noch Wachstum und nachhaltige Nachfrage?
3️⃣ Einzelhandelsimmobilien
Besonders interessant ist der Blick auf den Einzelhandel. In Japan dominieren kleinteilige, hochfrequentierte Lagen, fast immer in Mixed-Use-Strukturen. Erdgeschosse werden konsequent für Retail genutzt, während darüber Wohnen oder Büroflächen Platz finden. Dadurch bleibt die Anbindung an den Alltag der Menschen eng und stabil. Deutschland hingegen erlebt in Mittel- und Kleinstädten rückläufige Frequenzen. Gleichzeitig konsolidiert sich der Fachmarktbereich: Standorte müssen heute klarer denn je durch Lage, Mieterqualität und Anbindung überzeugen. Hier zeigt das japanische Modell, wie eng Einzelhandel, Nahversorgung und ÖPNV miteinander verzahnt sein können.
4️⃣ Flächennutzung und Effizienz
Japanische Projekte zeichnen sich durch die maximale Ausnutzung kleiner Grundstücke und äußerst kompakte, funktionale Grundrisse aus. Das entspricht der hohen Bevölkerungsdichte und dem enormen Druck auf den städtischen Bodenmarkt. Deutschland verfügt demgegenüber noch über größere Flächenreserven. Die Herausforderung liegt hier weniger in der Maximierung, sondern im Spagat zwischen Nachverdichtung und dem Erhalt bestehender Strukturen.
🌍 Fazit
Der Vergleich Japan–Deutschland verdeutlicht, dass Immobilienmärkte keine universellen Gesetzmäßigkeiten kennen, sondern durch Kultur, Demografie und gesellschaftliche Haltung geprägt sind. Während Japan auf Erneuerung, urbane Dichte und kleinteilige Retail-Strukturen setzt, ringen wir in Deutschland mit der Sanierung des Bestands, rückläufigen Frequenzen im Einzelhandel und regionalen Ungleichgewichten.
Gerade dieser Blick über den Tellerrand ist wertvoll: Er schärft die Perspektive auf den deutschen Markt und eröffnet neue Ansätze, wie wir mit den Herausforderungen von Bestand, Urbanisierung und Einzelhandelsentwicklung umgehen können.
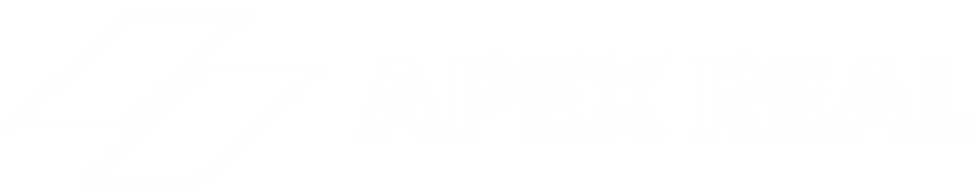



Kommentare